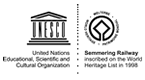| | Aktuelles | Info-Zentrum | Geschichte | Bahnwanderweg | Literatur | Seitenblicke | |
| | Veranstaltungen | Impressionen | Links | Fahrplan | Managementplan | Impressum |

| Die erste Bahn über den Semmering "... Da tat es schon ein kläglich Stöhnen. Auf der eisernen Straße heran kam ein kohlschwarzes Wesen. Es schien anfangs stillzustehen, wurde aber immer größer und nahte mit mächtigem Schnauben und Pfustern und stieß aus dem Rachen gewaltigen Dampf aus. Und hinterher …" "Kreuz Gottes!" rief mein Pate, "da hängen ja ganze Häuser dran!". Und wahrhaftig, wenn wir sonst gedacht hatten, an das Lokomotiv wären ein paar Steirerwäglein gespannt, auf denen die Reisenden sitzen konnten, so sahen wir nun einen ganzen Marktflecken mit vielen Fenstern heranrollen, und zu den Fenstern schauten lebendige Menschenköpfe heraus, und schrecklich schnell ging´s, und ein solches Brausen war, daß einem der Verstand still stand. Das bringt kein Herrgott mehr zum Stehen! fiel‘s mir noch ein. Da hub der Pate die beiden Hände empor und rief mit verzweifelter Stimme: "Jessas, Jessas, jetzt fahren sie richtig ins Loch!" Und schon war das Ungeheuer mit seinen hundert Rädern in der Tiefe." (Peter Rosegger bei seiner ersten Begegnung mit der Semmeringbahn)
Die Semmeringbahn wurde schon zu ihrer Zeit als "harmonische Kombination von Technologie und Natur" angesehen. Beeindruckend und faszinierend schlängelt sie sich durch steile Felswände hindurch, überquert Brücken und Viadukte, verschwindet immer wieder in einem der 15 Tunnels und bietet wunderschöne Ausblicke auf das Semmeringgebiet. Mit der Erfindung der Eisenbahn war es zum ersten Mal möglich, Strecken, für die vorher Tagesreisen erforderlich waren, in kurzer Zeit zurückzulegen. Eines konnte die Eisenbahn aber nicht überwinden – das Gebirge! Bereits Erzherzog Johann hatte die Idee, eine Bahnlinie von Wien nach Triest über den Semmering und nicht über Ungarn zu führen. 1841 erteilte der damalige Staatsminister Karl Friedrich Kübeck den Auftrag zur Errichtung einer Bahnlinie nach Triest. 1844 existierten die Bahnlinien von Wien nach Gloggnitz sowie von Mürzzuschlag nach Graz und nun galt es, eine Verbindung zwischen diesen beiden Strecken herzustellen.
Um das Problem, wie der Semmering zu bezwingen sei, kam es zu einem heftigen Expertenstreit. In diesem Zusammenhang kommen die Persönlichkeit und das technische Genie Carl von Ghegas ins Spiel. Der geborene Venezianer konzipierte nach einer Studienreise in die Vereinigten Staaten die Überschienung des Semmerings als Adhäsionsbahn, die mit einer wohl durchdachten Linienführung den Gebirgssattel überqueren sollte. 1848 wurden mit dem Eindruck der Revolution in Wien und zur Linderung der Arbeitslosigkeit die Baupläne für die Semmeringstrecke genehmigt und Carl Ghega, bekam die Bauleitung übertragen. In einer Rekordzeit von nur sechs Jahren wurde die Semmeringstrecke als die erste vollspurige Bergbahn Europas errichtet. Schwierige geologische Bedingungen, Schluchten, und Bergrücken erschwerten die Verlegung der Schienenstränge, sodass die zusätzliche Konstruktion von Tunnels, Viadukten und Brücken unumgänglich war. Bis zu 20.000 Arbeiter waren mit dem Bau beschäftigt, ausgestattet mit nur wenigen Baumaschinen und Schwarzpulver von geringer Sprengkraft. Etwa 1.000 Menschen verloren durch Unfälle, insbesondere aber durch Typhus und Cholera, ihr Leben.
Es galt jedoch auch noch ein anderes Problem zu lösen. Eine Dampflokomotive zu finden, die die enorme Steigung über den Semmering überwinden könnte. Zwei Jahre nach Baubeginn wurde ein Wettbewerb für Gebirgslokomotiven veranstaltet. Alle vier vorgestellten Lokomotiven (Bavaria, Vindobona, Wr. Neustadt und Seraing) erfüllten die Anforderungen und waren für die Semmeringtrasse geeignet. Wilhelm von Engerth erhielt den Auftrag, die Pläne der vier Konkurrenz-Lokomotiven aufeinander abzustimmen. Aus diesen Plänen ging die Serie der für lange Zeit typischen Semmering-Lokomotiven hervor. Am 23. Oktober 1853 fuhr zum ersten Mal eine Lokomotive über die gesamte Strecke. Am 16. Mai 1854 befuhren der Kaiser und die Kaiserin die Bahnstrecke, am 17. Juli 1854 konnte die Bahn feierlich eröffnet und dem allgemeinen Personenverkehr übergeben werden. Bis zum heutigen Tag hat sich an der Streckenführung nicht viel geändert, nur der längste Tunnel, der Semmeringtunnel, musste neu gebaut werden. Durch Wassereinbrüche waren Teile des Tunnels einsturzgefährdet und so wurde im Jahr 1952 der neue Tunnel mit einer Länge von 1511,5 m eröffnet.
Die Semmeringbahn überwindet eine, für damalige Verhältnisse unwahrscheinliche Höhendifferenz von 457 m, der höchste Punkt liegt auf 896 m. Die Strecke umfasst rund 41 km, 16 Viadukte (davon mehrere zweistöckig), 15 Tunnels und 100 gemauerte Bogenbrücken beziehungsweise Eisenbahnbrücken. Auf den Einsatz von Stahl und Eisen wurde vom Erbauer vollkommen verzichtet. 1998 wurde die Semmeringbahn vom UNESCO-Welterbe-Komitee zum Weltkulturerbe erklärt, mit der Begründung, dass sie „eine herausragende technische Lösung eines großen physikalischen Problems in der Konstruktion früherer Eisenbahnen repräsentiere“. Zum Gedenken an das Genie der Baukunst des Carl Ritter von Ghega steht ein Denkmal am Bahnhof Semmering. Dieses ist gleichzeitig auch Ausgangspunkt des Bahnwanderweges. Bilder: Erich Kodym, Johann Payr |
|||||||||||||||||